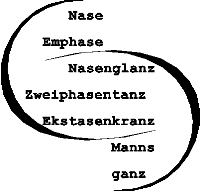Blutlaugensalzbeladen ziehn die Kähne Die wahren Gedichte der Gegenwart lernt man nicht durch Rezensionen kennen. Man findet sie weder in den Buchhandlungen und Bibliotheken noch unter »Neue Gedichte« im Feuilleton. Man wird ihrer durch Zufall teilhaftig; sie verbreiten sich auf die vor-gutenbergische Art: durch Abschriften und Briefe, wie seinerzeit Petrarcas Canzoniere. Allenfalls steht eines oder das andere in einer längst eingegangenen Zeitschrift oder einer Sammlung aus einem verschollenen Kleinverlag. Wer es nicht glaubt, der verifiziere die folgenden Stücke aus der Kollektion, die einem im Lauf eines fünfzigjährigen Lebens zuwächst. Das erste stammt von Dieter Frycia, der mir vor den fünfundzwanzig Jahren, seit denen ich ihn aus den Augen verloren habe, sein Veröffentlichungsplacet gab. Dieter Frycia Heute Verlasse ich dies wieder still gewordene Die Chaussee des Lichts entlang, streife Es sei nur einer weinend gesehen worden. Ich aber schreibe Vaterland an die geschlossenen Türen, Aber ich will aus dieser Nacht gehen ans Tor. Ebensowenig wie den Namen Dieter Frycia wird man den Namen R.Z. kennen. R.Z. (geb.1934) stimmte der Veröffentlichung des folgenden Liebesgedichts unter der Bedingung zu, daß sie anonym geschehe. R. Z. Möndlein Möndlein meiner Nacht Möndlein Möndlein meiner Nacht, Seh um Mitternacht erwacht Mit geschlossenen Augen ruht Nebels, Nebels und der Nacht Und Dieter Volkmann (ebenfalls geb.1934) kann sich gegen das Zitiertwerden sowieso nicht wehren: Volkmann, seit mehr als zwanzig Jahren schwerer Alkoholiker, »lebt«, unter Gebrechlichkeitspflegschaft, unheilbar verblödet, in einer Berliner Nervenklinik. Von ihm zitiere ich ein Gedicht von acht Zeilen *): Dieter Volkmann Ekloge I Drei Küsse Wind im Haar, das Herz voll Wiesen, Der Tod hat sich im Apfelbaum verstiegen, Vielleicht stört den Leser an diesen Gedichten ein »alter Duft aus Märchenzeit«. Daß sich der Tod im Apfelbaum verstiegen hat, ist tatsächlich ein (Grimmsches) Märchenmotiv: das Motiv vom utopischen Augenblick der angehaltenen Zeit, der Ewigkeit wird wie Suleikens Bild im sprechenden Spiegel. Die »Wiesen« Volkmanns sind ja die von vor dem Fallout von Tschernobyl; das »Möndlein« R.Z.s ist ja wohl noch der Mond vor seinem Altern unter den Beinen der Monderkundungsspinne; und wie weit muß man erst zurückgehen, um an den verschlossenen Türen das Wort »Vaterland« noch zu entziffern. – Wen also dieser alte Klang als »nicht modern genug« abstößt, nun, den verweise ich auf einen vierten Dichter, mit dem ich zum Kern dieses Aufsätzchens komme. Nicht, daß bei ihm die »alten Mären« fehlten – gleich durch die ersten Zeilen des nächstzuzitierenden Gedichts hört man ja den Schubertschen »Brunnen vor dem Tore« hindurchtönen –, aber sie sind alle entsetzlich zerstört, so, als wäre die Schrecksekunde über sie hingegangen, die durch die Verbannung des Todes in den Apfelbaum für einen trügerischen Ewigkeitsaugenblick noch hinausgezögert worden war. – Das Gedicht steht in einem gedruckten Lyrikband: Klaus M.Rarisch, Das gerettete Abendland; Songs und Hymnen. Aber es gehört dennoch hierher: denn wer wird schon bei einem Kleinverlag von wissenschaftlichem Programm (Wissenschaftlicher Verlag A.Lehmann, Gerbrunn, 1982), der zu kuriosen Bedingungen und ohne die Verpflichtung zu Werbung und Absatz auch Belletristik aufnimmt, nennenswerte Lyrik vermuten? Wer so ein Buch rezensieren? Klaus M.Rarisch Die Glatzenperücke Als jede Linde in dem Land entlaubt war, dieweil ihr Ohr für Schwichtigung ertaubt war, die spiegelglanzglattplatte Amtsperücke, Vor der Nation steht nackt von Fuß bis Scheitel Als ich 1983 durch einen Zufall Rarischs Gedichte in die Hand bekam, geriet ich alsbald in den Bann ihrer Klänge, die mich bis zur Belästigung verfolgten und sich noch nachts mir im Kopf drehten »wie blinde Schnucken auf der Heide«. Während einem doch oft das erinnernde Gedächtnis Synonyme unterschiebt, bis man unter den möglichen Varianten einer Reimzeile (etwa »dort darf die Brust in Tränen sich ergießen«; »dort wird das Herz in Klagen sich ergießen«; »dort mag das Aug in Tränen sich ergießen«; »dort kann die Brust in Klagen sich ergießen«) das Original kaum mehr herausfände, sitzt bei Rarisch jede Silbe so dicht in einem Gefüge von Assonanzen, daß sie zwischen den Nachbarwörtern und -silben eingeklemmt ist wie ein Steinchen zwischen den Nachbarsteinchen eines Mosaiks: keines kann man ver- oder ersetzen. Man probiere es mit dem Wort »schnöd« in der vierten Zeile: »schnöd« sitzt nicht nur unverwechselbar alliterierend hinter dem Wort »Schafsschlaf« (das sich auf »Brav-« binnenreimt), sondern noch mehr: es »blökt« sogar! Oder man versuche die alliterierenden Einsilbler »kahl« und »kühn« in Zeile 11 umzustellen, ohne daß es erstens sofort eine Dissonanz gäbe (ist doch das »ü« von »kühn« dem »i-Verlauf« in »das Schlimmste zu verhindern« benachbart). Und ohne daß man zweitens die Perspektive verlöre, die sich mit den Worten »Amtsperücke« und »König« auftut und die in einem Paar Epitheta ornantes heimlich bei »Karl dem Kühnen« (und vielleicht noch dem Kahlen) mündet: ein historischer Hintergrund, vor dem dann der Kanzler doppelt nackt vor der Nation steht. »Nackt«, das heißt: ratlos; ohne Hilfsmittel; mit leeren Händen; die traurige Wahrheit; der Offenbarungseid; die nuda veritas. Wie will man einem nackten Mann in die Tasche greifen? – Oder vielleicht doch nicht sowohl nackt als vielmehr mit Nacktheit zugleich »geschmückt« (»auf daß er sich als Glatzenkönig schmücke«): noch die »nackte Wahrheit« ja ist »Perücke«, was dem Wort »eitel« in Zeile 13 seinen Doppelsinn gibt. Vor welcher Nation kann der Kanzler schließlich stehen als vor der Fernsehnation? Immerhin: die Stummheit, die ihn in der letzten Zeile überfällt, ist ehrlich, wenn ihm vielleicht auch weniger der Laubverlust der Linden die Sprache verschlägt als die Ertaubung des öffentlichen Ohrs für weitere Beschwichtigungen. Aber das sind nur Deutungsversuche (des noch am leichtesten zu deutenden Sonetts aus dem »Geretteten Abendland«), die vieles offen lassen: Was heißt zum Beispiel »gewissensbissig«: wessen Gewissen ist es, das da um sich beißt? Und was heißt »umweltsumwälzungsbetört«: besagt es nicht, daß der Mob selber erst die Umwelt so tödlich umgewälzt hat, daß seine Empörung nun auch bloß wieder Mode ist? wie denn ja das Wort »Umweltsumwälzung« wie das zerstotterte Wort »Umwelt« klingt. Für dieses klangliche Zerkauen und Breitreden eines Modethemas bietet der Titel des folgenden Sonetts ein brillantes Beispiel: »Wiedervereineiigung«. Darin steckt »Wiedervereinigung« (und beim flüchtigen Hinblicken liest man es auch so), aber es klingt, als bekäme der Sprecher des Worts beim Diphthong »ei« die Maulsperre; er kommt vom Klang »ei« nicht los; es geht ihm wie dem im Dienst ergrauten und Kreide kauenden Cowboy in Rarischs »Teufelstrillersonett«: Umsonst! Sein Schrei bleibt »Ei«. »Ei« trifft nicht zu. Aber siehe da: »Ei« trifft doch zu: Klang, Silbe und Wort fallen ineins: Klaus M.Rarisch Wiedervereineiigung Ein Siamzwilling, sanft wie einst Paul Heyse, Da kommt de Gaulle auf einer Galareise Doch unbeglänzt vom fremden Nasenglanz so zum Ekstasenkranz verschlungen beide, Das Gedicht ist noch rätselhafter – bei einer absurden Kohärenz des Disparaten. Horcht man in die Klänge, so sieht man gerade im zweiten Quartett, das thematisch herauszufallen scheint, ein Assonanzengewebe sich anspinnen, dessen Auslöser genau die »Nase« ist, die da de Gaulle in die siamesischen Angelegenheiten steckt. Auf »Nase« reimt sich (stets im Innern der Zeilen) »Emphase«, »Phase«, »Ekstase«, wobei sich diesen Reimen ein zweiter Reim anzuhängen beginnt, der sich mit ihm zum »reichen« oder »Doppelreim« verbindet: »Glanz« zu »Nasenglanz«, »Tanz« zu »Zweiphasentanz«, »Kranz« zu »Ekstasenkranz«, bis zuletzt dieser zweite Reim unverbunden übrigbleibt: »Manns« und (in der Mitte der letzten Zeile) »ganz«. Graphisch dargestellt folgende Mischung und Entmischung
– das getreue Bild des Tanzes selbst, ja sogar vom Weibesleib und dem Leib des Manns. »Nase« (und alles, was sich darauf reimt) ist ein Wort weiblicher Endung; »Glanz« (und alles, was sich darauf reimt) ein männliches Reimwort; zum Kompositum sind sie »verschlungen beide« ... Ist diese Koinzidenz Zufall, dann ein solcher, der »im unbewußten Momente« nur einem Dichter geschenkt wird. Einem Dichter von absurdem Humor, der die Eckreime seiner Quartette spitz in die falsche Aussprache eines Fremdworts zulaufen läßt. (Indessen: »laut die Marseillaise« ist selber ein Witz: das »laise« der Marseillaise ist ja das Gegenteil von »laut«.) Dabei ist das Gedicht tief traurig: etwas Geheimnisvolles darin führt uns auf neue Art an die verschlossenen Türen des Vaterlands. Auch das »Siam«, das de Gaulles Nase beglänzt, sind wohl wir; und die Massen, die die Hymne eines mit sich selbst identischen Volks mit so kompensativer Emphase intonieren, vielleicht mit jenen Zwillingshälften identisch, die weder sich wiedervereineiigen noch voneinander loskommen können und stets um einander, um sich und ihr unlösbares Problem kreisen, bis – tröstlicher Schluß! – : »bis daß der Tod sie. scheide«. So leben wir also noch, und das ist für Rarisch keineswegs selbstverständlich. Freilich: wie. Damit kommen wir zum letzten der hier zu zitierenden Gedichte: Gleich dem »Möndlein« ist es ein Nachtgedicht, aber sein Thema ist solch globale Umnachtung, daß in ihr keinerlei Gestirn mehr blinkt und wir ratlos tappend uns darin drehn »wie blinde Schnucken auf der Heide« ... »Wann dämmert aasiges Gewesensein?« Dies ist, wenn wir die Landschaft des »Geretteten Abendlands« durchstreifen, längst der Fall. »Die Stundengläser sind schon sandentleert«, heißt es in dem Sonett »Sterbenslänglich«; » – noch ehe er zu Aas wird, stirbt sein Sehnen« im »Prolog zum Nihil«; »Blutlaugensalzbeladen ziehn die Kähne / zu fremden Häfen. Herz, mein Herz, fahr wohl!« im Gedicht »Totensonnabend«. Der »Totensonnabend« ist der Tag, dem der Totentanz selbst folgen wird: das Wochenende jene zerfallende »Ewigkeit« vor dem Weltende: »Sekunden, von denen jede ewig währt« (»Sterbenslänglich«): der Tod steht schon (am Brunnen) vor dem Tor; noch sitzt er in dem (entlaubten) Baum; und noch und immer noch eine Sekunde ist uns vergönnt, bis man ihn entbannt. Der Zeile »Die Geigerzähler hören auf zu ticken« bedürfte es vielleicht gar nicht; sie bezeichnet nur das physische Ende, dem der Zusammenbruch des Geistes lange voraufgegangen ist. Wohl das schönste Gedicht Rarischs, eines der ganz großen Sonette deutscher Sprache, datiert den Augenblick dieses Einsturzes auf ein Jahr (1889), ja auf den Tag (7.1.) genau. Seitdem dämmert die Welt dahin, zu deren klarem Tag sich das Bewußtsein über so viele Stufen hatte heraufringen müssen: Ich –: über die Erkenntnis, das Ebenbild Gottes zu sein, über die Gesetzestafeln, den babylonischen Turmbau, die Sintflut, den Stern des Bundes und, nachdem wir es denn so herrlich weit gebracht, die skeptische Frage, ob wir nicht besser (wie es Benn formuliert hat) »ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor« geblieben wären. Was seit dem Zusammenbruch Nietzsches gedacht und geformt worden ist, verdankt sich blitzhaft-»lichten Augenblicken« in der Nacht des Geistes: »Im Aug des Toten züngeln noch die Farben / zum Zackenblitz Erinnerung zusammen« –: das gilt für Volkmanns »Ekloge«, R.Z.s »Möndlein« und Frycias Verse ebensowohl wie für die vierzehn Zeilen Rarischs, in denen noch einmal, wie in einer Nußschale, der ganze Zyklus der alten Welt enthalten ist. Das Gedicht »Menschüber – menschunter«, nach Erscheinen des »Geretteten Abendlands« entstanden, steht nirgends gedruckt; es hat sich bisher – damit schließt sich der Bogen zum Ausgangspunkt dieses Aufsätzchens – abschriftweise und brieflich herumgesprochen und wird, mit der Erlaubnis des Dichters, hier erstmalig veröffentlicht. Klaus M.Rarisch Menschüber – menschunter Wer war es, wer sprach einst das Wort aus: Ich? Erkannte er, wem da sein Bildnis glich? Wie lange kann der klare Tag noch währen? Gebären neue Mythen sich und Mären?
* ) Nach einer Abschrift. Das Gedicht ist allerdings einmal veröffentlicht worden in: sammlung leinfelden – handbuch neue lyrik, Leinfelden 1964, S. 42. Der Aufsatz entstand 1986 – vor der Wende – und blieb damals ungedruckt; die zitierten Sonette erschienen vier Jahre später als Meiendorfer Druck 20 (Klaus M. Rarisch: Die Geigerzähler hören auf zu ticken. Neunundneunzig Sonette mit einem Selbstkommentar).
|
Rechte bei Ernst-Jürgen Dreyer